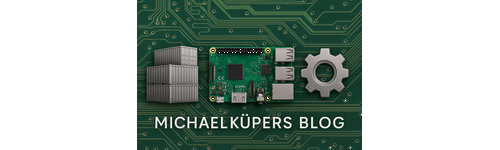Allgemeines
In diesem Bereich erscheinen Beiträge zu allgemeinen Themen – Beobachtungen, Einschätzungen und Gedanken zu gesellschaftlichen Entwicklungen, Technik und Alltag. Offen, kritisch und ohne feste Kategorie.
Stellen wir uns eine Infrastruktur vor, in der die sensibelsten Gesundheitsdaten aller Bürger:innen digital zugänglich sind – vernetzt über zentrale Plattformen, gesteuert durch spezialisierte Konnektoren, betrieben von wenigen großen Softwareanbietern. Diese Infrastruktur existiert bereits: Es ist die Telematikinfrastruktur (TI) mit der elektronischen Patientenakte (ePA).
Mehrere große Anbieter liefern heute sowohl die Konnektoren als auch die Arztsoftware, mit der Diagnosen, Rezepte und Therapien dokumentiert werden. Diese Software greift auf Diagnosecodes, Medikationshistorien und Therapiepläne zu. Wer ein solches System betreibt, könnte – technisch gesehen – Profile über psychische Erkrankungen, soziale Hintergründe oder andere sensible Merkmale extrahieren, sofern das gewollt (oder befohlen) wäre.
Die Unternehmen betonen zwar Datenschutz und Sicherheit, doch Transparenz fehlt: Der Quellcode ist nicht offen, die genaue Datenverarbeitung bleibt betriebsintern. Vertrauen ist nötig – Kontrolle kaum möglich. Brisant wird es zusätzlich, wenn Teile der Infrastruktur – etwa Cloud-Plattformen oder Rechenzentren – unter der Kontrolle außereuropäischer Unternehmen stehen, insbesondere wenn diese dem US Cloud Act unterliegen. Damit wäre zumindest theoretisch eine Datenweitergabe an US-Behörden möglich, selbst wenn sich die Server physisch in Europa befinden.
Warum das politisch brisant ist
Wenn führende Politiker wie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann öffentlich darüber sprechen, psychisch Kranke stärker zu erfassen oder gar zu registrieren, dann wird aus technischer Möglichkeit plötzlich eine politische Gefahr. Die Werkzeuge wären (theoretisch) da. Es bräuchte nur den politischen Willen – oder den politischen Druck auf die Betreiber dieser Infrastruktur.
Was wir brauchen
Wir brauchen nicht weniger Digitalisierung, sondern mehr Kontrolle, mehr Transparenz und echte Gewaltenteilung in der digitalen Infrastruktur:
-
Offene Standards und öffentlich einsehbaren Quellcode für kritische Gesundheits-IT
-
Unabhängige Aufsichtsgremien mit zivilgesellschaftlicher Beteiligung
-
Strenge gesetzliche Grenzen für Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten – auch im Rahmen vermeintlicher Sicherheitsinteressen
-
Klare Begrenzungen und Kontrolle bei der Einbindung von Infrastruktur-Anbietern aus Drittstaaten
Fazit
Die Kombination aus zentralisierter Gesundheitsdateninfrastruktur, marktbeherrschenden IT-Unternehmen, international vernetzten Cloudsystemen und autoritären politischen Vorstößen ist hochriskant. Gerade weil unsere Geschichte uns mahnt, sensibel zu sein für das, was technisch möglich ist – und was politisch denkbar wird.
Demokratie braucht Schutzräume. Die ePA darf keiner Trojanerpolitik geopfert werden.
Hinweis: Dieser Beitrag erhebt keinen Vorwurf gegen einzelne Unternehmen oder Personen, sondern beleuchtet Risiken, die aus der Kombination technischer, wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen entstehen können.
#ePA #Gesundheitsdaten #Demokratie #Überwachung #Meinung #CloudAct
- Details
- Geschrieben von: Michael Küper
- Kategorie: Allgemeines
- Zugriffe: 237
Einleitung
„Die Rente ist nicht mehr sicher.“ Ein Satz, der in politischen Talkshows, Leitartikeln und Ministeriumsverlautbarungen mantraartig wiederholt wird. Schuld daran seien die Babyboomer, die länger lebenden Menschen, die sinkende Geburtenrate. Die Botschaft: Wir können nichts tun, außer das Renteneintrittsalter zu erhöhen, die Beiträge zu steigern und das Niveau abzusenken. Aber stimmt das wirklich? Oder hätten politische Entscheidungen der vergangenen Jahrzehnte das System deutlich stabiler machen können?
1. Die Wahrheit über die Babyboomer
Die geburtenstarken Jahrgänge (ca. 1955 bis 1969) gehen derzeit nach und nach in Rente. Ja, das ist eine Herausforderung für das Umlagesystem, denn mehr Menschen beziehen Leistungen, während weniger einzahlen. Aber diese Entwicklung ist nicht dauerhaft: Spätestens ab den 2040er Jahren nimmt die Zahl der Rente beziehenden durch den demografischen Rückgang auch wieder ab. Es handelt sich also um eine temporäre Belastungsspitze, nicht um einen Kollaps.
Hinzu kommt: Viele Babyboomer haben Jahrzehnte lang in die Rentenkasse eingezahlt und damit das System mitgetragen. Sie nun zum Problem zu erklären, ist nicht nur moralisch fragwürdig, sondern auch analytisch verkürzend.
2. Was das Umlagesystem wirklich braucht
Das Umlageverfahren ist im Kern stabil, wenn die Beitragsbasis groß genug ist. Es braucht:
-
Genügend Erwerbstätige,
-
ausreichend hohe Löhne,
-
und eine gerechte Lastenverteilung.
Was es nicht braucht, sind politisch gewollte Lücken: Der Ausschluss ganzer Berufsgruppen, steuerliche Subventionen für private Vorsorge und ein Arbeitsmarkt, der prekäre Beschäftigung begünstigt, schwächen die Solidarität und damit das System insgesamt.
3. Wer heute nicht einzahlt – und warum das ein Problem ist
Beamte, viele Selbstständige, Freiberufler:innen in Versorgungswerken und Millionen Minijobber:innen zahlen nicht oder nur minimal in die gesetzliche Rentenkasse ein. Das bedeutet:
-
Eine geringere Zahl von Beitragszahler:innen,
-
eine Verzerrung in der Verteilung der Lasten,
-
und ein strukturelles Einnahmeproblem, das nicht auf Demografie, sondern auf politische Ausgrenzung zurückgeht.
4. Was wäre, wenn alle einzahlen müssten?
Ein Blick in die Zahlen zeigt: Wenn alle Erwerbstätigen in die Rentenversicherung einzahlen würden, wäre das System deutlich stabiler.
Allein durch die Einbeziehung von:
-
ca. 4,9 Mio. Beamten,
-
ca. 4,2 Mio. Selbstständigen,
-
und rund 300.000 Freiberufler:innen,
könnte man die Beitragsbasis um etwa 10 Mio. gutverdienende Menschen erweitern. Bei einem geschätzten Durchschnittseinkommen von 60.000 Euro und einem Beitragssatz von 20 % ergäbe das jährliche Mehreinnahmen von rund 120 Milliarden Euro.
Diese Einnahmen würden nicht nur die kurzfristige Belastung durch die Babyboomer ausgleichen, sondern könnten auch dazu beitragen, das Rentenniveau zu stabilisieren und Altersarmut zu bekämpfen.
5. Weitere politische Stellschrauben
Neben der Einbeziehung aller in die Rentenversicherung gibt es weitere Möglichkeiten, das System zukunftsfest zu machen:
-
Arbeitsmarktpolitik: Mehr Tarifbindung, weniger prekäre Arbeit, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhöhen die Zahl der Beitragsjahre.
-
Zweckgebundener Bundeszuschuss: Versicherungsfremde Leistungen (wie Kindererziehungszeiten) sollten aus Steuermitteln gezahlt werden, nicht aus Beiträgen.
-
Produktivitätsgewinne nutzen: Wenn weniger Menschen durch Technik mehr erwirtschaften, können sie auch mehr einzahlen.
-
Zuwanderung steuern und integrieren: Wer dauerhaft hier lebt und arbeitet, sollte auch einzahlen können.
Fazit: Demografie ist keine Ausrede
Die These von der „nicht mehr sicheren Rente“ ist nur dann plausibel, wenn man zentrale Reformen bewusst unterlässt. Die Probleme des Rentensystems sind nicht biologischer, sondern politischer Natur. Wer auf die Babyboomer zeigt, verschleiert die eigentlichen Ursachen: Jahrzehntelange Entscheidungen, die das System ausgehöhlt haben, anstatt es zu stärken.
Es ist nicht zu spät, das zu ändern. Aber es braucht den politischen Willen, endlich alle einzubeziehen. Nicht nur beim Arbeiten – sondern auch beim Tragen der Verantwortung.
- Details
- Geschrieben von: Michael Küper
- Kategorie: Allgemeines
- Zugriffe: 327
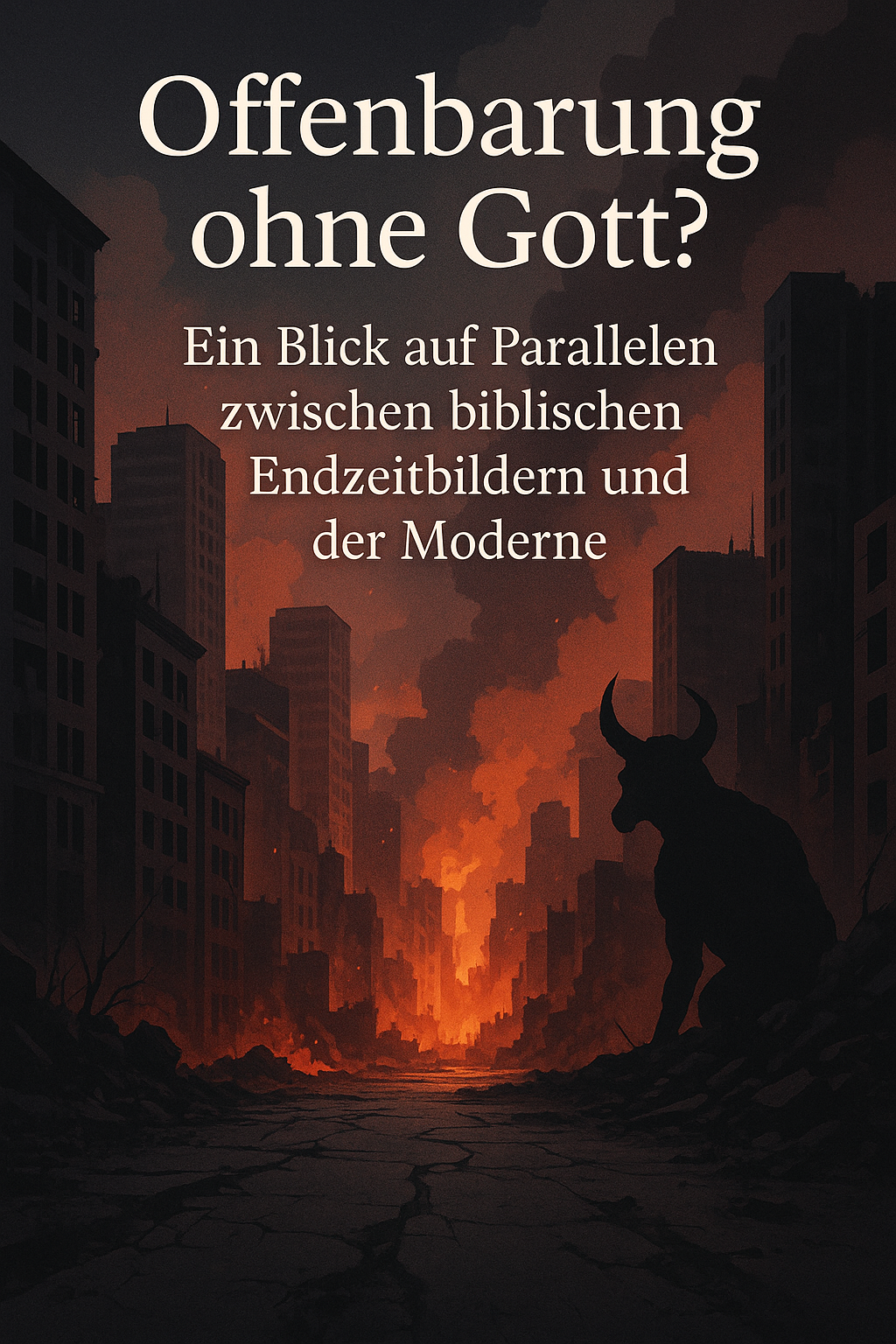
Man muss kein gläubiger Mensch sein, um zu spüren: Unsere Zeit ist aus den Fugen geraten. Klimakrise, politische Instabilität, technologische Kontrollverluste – vieles wirkt, als stünden wir vor einem Kipppunkt. Und so drängt sich plötzlich wieder ein altes Motiv in unser Denken: die Offenbarung.
Dabei geht es mir nicht um religiöse Endzeitprophetie. Sondern um eine tiefere, philosophische Frage: Gibt es Parallelen zwischen dem, was die biblische Offenbarung beschreibt – und dem, was wir heute erleben?
Endzeitstimmung ohne Erlöser
Die Apokalypse im biblischen Sinne folgt einem Ziel: Sie zerstört, um etwas Neues zu schaffen. Das Böse wird gerichtet, das Gute erlöst. Unsere Gegenwart kennt kein solches Ziel. Sie kennt nur Krisen, die sich überlagern, ohne Erlösungsperspektive.
Der Philosoph Günther Anders sprach davon, dass wir die Katastrophe längst erkannt haben – aber nicht danach handeln. Er nannte das „Apokalypse-Blindheit“. Wir sehen die Gefahr, aber tun so, als sei noch Zeit.
Offenbarung als Entbergung
Im Kern bedeutet „Offenbarung“: Etwas wird sichtbar, was zuvor verborgen war. Wahrheit tritt ans Licht. Heute erleben wir genau das:
-
Die ökologischen Folgen unseres Handelns werden unübersehbar.
-
Die politischen Systeme zeigen ihre Schwächen.
-
Technologische Entwicklungen entgleiten demokratischer Kontrolle.
Doch anders als im biblischen Text folgt auf diese Entbergung kein göttliches Urteil. Nur wir selbst könnten reagieren – und tun es oft nicht.
Das neue „Tier“: Systeme außer Kontrolle
In der Johannesoffenbarung taucht ein bedrohliches Tier auf – ein Symbol für Machtmissbrauch, Chaos und das Böse. In unserer Zeit hat dieses Tier neue Formen:
-
globale Konzerne mit unkontrollierbarem Einfluss,
-
Künstliche Intelligenz, deren Entscheidungen wir kaum noch verstehen,
-
Märkte, die Menschen und Natur gleichgültig behandeln.
Diese Systeme sind menschengemacht – und doch entziehen sie sich menschlicher Kontrolle. Vielleicht ist das die eigentliche Apokalypse unserer Zeit: dass wir unsere Schöpfungen nicht mehr bändigen können.
Hoffnung – aber ohne Garantie
Trotz allem endet die biblische Offenbarung mit einem Bild der Hoffnung: dem „neuen Jerusalem“. Auch in der Philosophie gibt es diese Hoffnung – aber sie kommt nicht von außen. Sie liegt in der Verantwortung, die wir füreinander und für den Planeten übernehmen.
Ernst Bloch nannte das Prinzip Hoffnung. Habermas glaubte an die Kraft des Diskurses. Bruno Latour entwarf ein neues Gleichgewicht zwischen Mensch und Erde. Es gibt also Gegenentwürfe – aber keine göttliche Garantie. Wir müssen sie selbst Wirklichkeit werden lassen.
Fazit
Die Offenbarung lebt – nicht als göttliches Versprechen, sondern als Spiegel unserer Zeit. Die Apokalypse ist nicht mehr das Ende der Welt, sondern das Ende von Illusionen. Und vielleicht liegt genau darin unsere Chance: Die Dinge, die wir sehen, können wir auch verändern. Wenn wir es wollen.
- Details
- Geschrieben von: Michael Küper
- Kategorie: Allgemeines
- Zugriffe: 159
In Zeiten zunehmender Sensibilität für Gleichstellung und Diversität stellt sich vielen Unternehmen die Frage: Wie können wir Bewerbungsprozesse gestalten, die weder ethnische Herkunft, noch Geschlecht oder Alter berücksichtigen – und dennoch die besten Kandidat:innen auswählen?
Die gute Nachricht: Es gibt erprobte Verfahren, um genau das zu erreichen – und sie sind einfacher umzusetzen, als viele denken.
1. Anonymisierte Bewerbung als erste Hürde gegen Vorurteile
Der erste Eindruck zählt – aber er ist oft trügerisch. Ein Name kann Herkunft vermuten lassen, ein Foto unbewusstes Schubladendenken auslösen, das Geburtsdatum vermeintlich Rückschlüsse auf Leistungsfähigkeit erlauben.
Die Lösung: In der ersten Sichtungsrunde werden Bewerbungen anonymisiert. Konkret heißt das:
-
Kein Name, kein Foto
-
Kein Geburtsdatum oder Alter
-
Keine Angaben zu Geschlecht, Nationalität oder Familienstand
-
Optional: Schulen oder Universitäten durch neutrale Bezeichnungen ersetzen
Was bleibt, ist das Wesentliche: Erfahrung, Fähigkeiten und Motivation.
2. Gleiche Maßstäbe für alle – mit einem festen Kriterienkatalog
Subjektive Bauchgefühle sind die größte Gefahr für faire Entscheidungen. Deshalb braucht es klar definierte Bewertungskriterien, z. B.:
-
Fachkenntnisse
-
Projekterfahrung
-
Relevante Weiterbildungen
-
Arbeitsproben oder Referenzprojekte
-
ggf. Sprachkenntnisse oder Softwaretools
Diese Kriterien werden vor dem Start des Auswahlverfahrens festgelegt und gewichtet – so bleibt der Prozess objektiv.
3. Kompetenz schlägt Lebenslauf: Tests und Arbeitsproben
Ein Lebenslauf sagt nicht immer etwas über tatsächliche Fähigkeiten aus. Deshalb sollten realitätsnahe Aufgabenstellungen zum Auswahlprozess gehören:
-
Fallstudien oder Szenarien aus dem Arbeitsalltag
-
Kleine Programmier- oder Schreibaufgaben
-
Logiktests oder Problemlösungen
So zeigt sich schnell, wer die gefragten Kompetenzen wirklich mitbringt – unabhängig vom bisherigen Karriereweg.
4. Erstgespräch ohne Kamera – Fokus auf Inhalt, nicht Äußerlichkeiten
Im ersten Interview verzichten einige Unternehmen bewusst auf Video oder Kamera. Warum?
Weil Äußerlichkeiten wie Hautfarbe, Kleidung oder Alter oft ungewollt Einfluss nehmen. Ein Gespräch per Telefon oder Chat mit strukturierten Fragen bringt deutlich mehr Fairness.
5. Strukturierte Interviews mit Punktesystem
Spätestens im persönlichen Gespräch droht wieder der Einfluss subjektiver Eindrücke. Um dem entgegenzuwirken, helfen strukturierte Interviews:
-
Alle Bewerber:innen erhalten dieselben Fragen
-
Die Antworten werden nach einem vorher abgestimmten Punkteschema bewertet
-
Ideal: Mehrere Personen beurteilen unabhängig voneinander
So entstehen vergleichbare Einschätzungen – nicht vergleichbare Sympathien.
6. Entscheidung im Team – Diversität schützt vor blinden Flecken
Die endgültige Auswahl sollte nicht allein getroffen werden. Ein divers zusammengesetztes Auswahlgremium – idealerweise geschlechtergemischt und aus unterschiedlichen Abteilungen – reduziert das Risiko von Einseitigkeiten und Vorannahmen.
7. Transparente Rückmeldung
Auch wenn eine Bewerbung nicht erfolgreich ist: Wer nachvollziehbar erfährt, warum, empfindet das Verfahren meist als fair. Und wer weiß: Vielleicht klappt es beim nächsten Mal.
Fazit: Nicht perfekt – aber deutlich besser
Ein diskriminierungsfreier Bewerbungsprozess ist kein Hexenwerk. Er erfordert Struktur, klare Kriterien und den Willen, unbewusste Vorurteile systematisch auszuschalten.
Vollständig neutral bleibt kein Prozess. Aber durch Anonymisierung, Kompetenztests und strukturierte Gespräche kann die Auswahl fairer, transparenter und letztlich auch treffsicherer werden.
Und das ist nicht nur gerecht – sondern auch gut für jedes Unternehmen, das wirklich die besten Talente sucht.
Du willst diesen Ansatz bei dir im Unternehmen einführen oder weiterdenken? Ich freue mich über den Austausch in den Kommentaren oder per Nachricht.
- Details
- Geschrieben von: Michael Küper
- Kategorie: Allgemeines
- Zugriffe: 57
Enter drücken und ChatGPT sendet sofort ab?
Wer längere Texte formuliert oder Gedanken in Absätzen strukturieren will, kennt das Problem:
Ein versehentliches Enter – und der Prompt ist raus.
Ich wollte das ändern. Also habe ich mit Hilfe von ChatGPT (genauer gesagt: S.A.R.A.H.) eine eigene Browser-Erweiterung gebaut, die das Verhalten umkehrt:
-
Enter→ macht einen Zeilenumbruch -
Shift + Enter→ sendet den Prompt
Klingt einfach? War’s nicht.
Denn: ChatGPT verwendet kein klassisches <textarea> mehr, sondern ein div mit contenteditable. Das Eingabefeld wird zudem dynamisch geladen, was viele Erweiterungen und Userscripts ins Leere laufen lässt.
Gemeinsam haben wir:
-
den richtigen DOM-Selektor gefunden (
#prompt-textarea) -
mit einem
MutationObserverauf DOM-Änderungen reagiert -
Tastenevents frühzeitig abgefangen und überschrieben
-
eine stabile und leicht verständliche Browser-Erweiterung gebaut
Die fertige Erweiterung kannst du hier herunterladen:
(Anleitung zur Installation siehe unten.)
Installation (Chrome/Chromium/Vivaldi):
-
ZIP-Datei herunterladen und entpacken
-
chrome://extensionsöffnen -
Entwicklermodus oben rechts aktivieren
-
„Entpackte Erweiterung laden“ klicken
-
Den entpackten Ordner auswählen
-
ChatGPT-Seite neu laden – fertig
Was ich gelernt habe:
-
contenteditableist trickreicher alstextarea -
ChatGPTs DOM ändert sich oft – harte Selektoren reichen nicht aus
-
Vivaldi blockiert manche Erweiterungsfunktionen strenger als Chromium
Was du davon hast?
Kontrolle über deinen Schreibfluss – ganz ohne Frust.
Viel Spaß beim Nachbauen, Anpassen oder einfach Nutzen.
- Details
- Geschrieben von: Michael Küper
- Kategorie: Allgemeines
- Zugriffe: 27