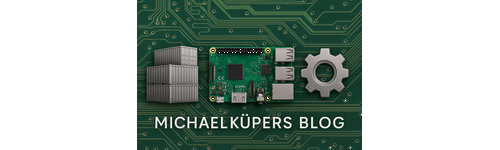Von Kreuzzügen, Hexenverfolgung und Mustern, die wir heute noch sehen
Die Frage klingt frech – fast respektlos. Aber sie drängt sich auf, wenn man Kreuzzüge oder Hexenverfolgungen betrachtet.
Auf der einen Seite: die Worte Jesu über Nächstenliebe, Gewaltlosigkeit und Vergebung.
Auf der anderen Seite: Jahrhunderte Gewalt legitimiert im Namen eben dieses Jesus.
Wie passt das zusammen?
Wenn Glaube zur Waffe wird
Religiöse Gewalt ist kein exklusives Phänomen des Christentums, aber die Diskrepanz zwischen Jesu Lehre und mancher Kirchengeschichte ist besonders auffällig. Um das zu verstehen, lohnt ein Blick auf zwei der dunkelsten Kapitel: Kreuzzüge und Hexenverfolgung.
Kreuzzüge: Sündenfrei durch Schwert und Schild
1095 rief Papst Urban II. zum ersten Kreuzzug auf. Wer mitkämpfte, bekam laut Versprechen die Sünden erlassen – ein direkter „Freifahrtschein“ ins Paradies.
Offiziell ging es um den Schutz der heiligen Stätten in Jerusalem. In der Praxis ging es auch um Macht, Land und Handelswege.
Die Gegner wurden zu „Ungläubigen“ erklärt, deren Tötung nicht als Mord galt, sondern als Gottesdienst.
Hexenjagd – der lange Arm der Angst
Zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert wurden Zehntausende als Hexen hingerichtet – meist Frauen. Die Bibelstelle „Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen“ (Exodus 22,17) diente als Totschlagargument.
Theologen lieferten mit dem Hexenhammer sogar ein Handbuch, wie man Folter und Hinrichtung „gottgewollt“ erscheinen lassen konnte.
In Wirklichkeit ging es oft um Besitz, Macht oder das Ausschalten unbequemer Menschen.
Jesu Botschaft kontra kirchliche Praxis
| Jesu Lehre | Kirchliche Praxis |
|---|---|
| Liebe deinen Nächsten | Gegner sind keine „Nächsten“, sondern Feinde Gottes |
| Gewaltlosigkeit | Krieg als göttliches Werkzeug |
| Vergebung | Sündenvergebung nur durch Teilnahme an Gewalt |
| Gleichwertigkeit aller | Strikte Trennung: Gläubige vs. Ungläubige |
| Keine Zwangsbekehrung | Zwangstaufen unter Todesdrohung |
Alte Tricks, neue Verpackung
Wer die Argumentation der damaligen Kirche analysiert, erkennt ein wiederkehrendes Schema:
- Feindbild schaffen – der Gegner ist unmenschlich oder böse.
- Texte selektiv auslegen – nur die passenden Passagen zählen.
- Höheres Ziel vorschieben – Gewalt wird moralisch „reingewaschen“.
- Teilnahme belohnen – wer mitmacht, gilt als Held oder Retter.
- Machtbündnis schmieden – Politik und Religion sichern einander ab.
Diese Mechanismen sind keine Relikte. Sie leben fort – in abgeschwächter, modernisierter Form:
- Wenn Geflüchtete als „Gefahr für unsere Werte“ gebrandmarkt werden.
- Wenn Verfassungsartikel aus dem Zusammenhang gerissen werden, um Grundrechte einzuschränken.
- Wenn Kriege als „humanitäre Intervention“ verkauft werden, während handfeste Machtinteressen im Hintergrund wirken.
Checkliste: 6 Warnzeichen
- Feindbildbildung
- Selektive Autoritätszitate
- „Höheres Ziel“ als moralischer Joker
- Moralische Belohnung für Teilnahme
- Allianz von Religion und Politik
- Dämonisierung und Entmenschlichung
Merksatz:
Sobald eine Seite moralisch unantastbar erklärt wird und die Gegenseite zum Feind der Menschheit, wiederholt sich Geschichte.
Fazit
Ob Christen jemals „christlich“ waren, hängt vom Maßstab ab.
An Jesu Botschaft gemessen: oft nicht.
An der damaligen Selbstdefinition: ja – und genau darin lag die Gefahr.
Denn wer sich moralisch unfehlbar wähnt, findet immer einen Weg, Gewalt zu rechtfertigen.
Geschichte zeigt: Die Etiketten ändern sich. Die Muster bleiben.