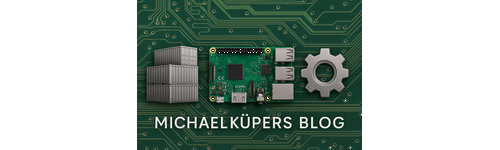Einleitung
„Die Rente ist nicht mehr sicher.“ Ein Satz, der in politischen Talkshows, Leitartikeln und Ministeriumsverlautbarungen mantraartig wiederholt wird. Schuld daran seien die Babyboomer, die länger lebenden Menschen, die sinkende Geburtenrate. Die Botschaft: Wir können nichts tun, außer das Renteneintrittsalter zu erhöhen, die Beiträge zu steigern und das Niveau abzusenken. Aber stimmt das wirklich? Oder hätten politische Entscheidungen der vergangenen Jahrzehnte das System deutlich stabiler machen können?
1. Die Wahrheit über die Babyboomer
Die geburtenstarken Jahrgänge (ca. 1955 bis 1969) gehen derzeit nach und nach in Rente. Ja, das ist eine Herausforderung für das Umlagesystem, denn mehr Menschen beziehen Leistungen, während weniger einzahlen. Aber diese Entwicklung ist nicht dauerhaft: Spätestens ab den 2040er Jahren nimmt die Zahl der Rente beziehenden durch den demografischen Rückgang auch wieder ab. Es handelt sich also um eine temporäre Belastungsspitze, nicht um einen Kollaps.
Hinzu kommt: Viele Babyboomer haben Jahrzehnte lang in die Rentenkasse eingezahlt und damit das System mitgetragen. Sie nun zum Problem zu erklären, ist nicht nur moralisch fragwürdig, sondern auch analytisch verkürzend.
2. Was das Umlagesystem wirklich braucht
Das Umlageverfahren ist im Kern stabil, wenn die Beitragsbasis groß genug ist. Es braucht:
-
Genügend Erwerbstätige,
-
ausreichend hohe Löhne,
-
und eine gerechte Lastenverteilung.
Was es nicht braucht, sind politisch gewollte Lücken: Der Ausschluss ganzer Berufsgruppen, steuerliche Subventionen für private Vorsorge und ein Arbeitsmarkt, der prekäre Beschäftigung begünstigt, schwächen die Solidarität und damit das System insgesamt.
3. Wer heute nicht einzahlt – und warum das ein Problem ist
Beamte, viele Selbstständige, Freiberufler:innen in Versorgungswerken und Millionen Minijobber:innen zahlen nicht oder nur minimal in die gesetzliche Rentenkasse ein. Das bedeutet:
-
Eine geringere Zahl von Beitragszahler:innen,
-
eine Verzerrung in der Verteilung der Lasten,
-
und ein strukturelles Einnahmeproblem, das nicht auf Demografie, sondern auf politische Ausgrenzung zurückgeht.
4. Was wäre, wenn alle einzahlen müssten?
Ein Blick in die Zahlen zeigt: Wenn alle Erwerbstätigen in die Rentenversicherung einzahlen würden, wäre das System deutlich stabiler.
Allein durch die Einbeziehung von:
-
ca. 4,9 Mio. Beamten,
-
ca. 4,2 Mio. Selbstständigen,
-
und rund 300.000 Freiberufler:innen,
könnte man die Beitragsbasis um etwa 10 Mio. gutverdienende Menschen erweitern. Bei einem geschätzten Durchschnittseinkommen von 60.000 Euro und einem Beitragssatz von 20 % ergäbe das jährliche Mehreinnahmen von rund 120 Milliarden Euro.
Diese Einnahmen würden nicht nur die kurzfristige Belastung durch die Babyboomer ausgleichen, sondern könnten auch dazu beitragen, das Rentenniveau zu stabilisieren und Altersarmut zu bekämpfen.
5. Weitere politische Stellschrauben
Neben der Einbeziehung aller in die Rentenversicherung gibt es weitere Möglichkeiten, das System zukunftsfest zu machen:
-
Arbeitsmarktpolitik: Mehr Tarifbindung, weniger prekäre Arbeit, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhöhen die Zahl der Beitragsjahre.
-
Zweckgebundener Bundeszuschuss: Versicherungsfremde Leistungen (wie Kindererziehungszeiten) sollten aus Steuermitteln gezahlt werden, nicht aus Beiträgen.
-
Produktivitätsgewinne nutzen: Wenn weniger Menschen durch Technik mehr erwirtschaften, können sie auch mehr einzahlen.
-
Zuwanderung steuern und integrieren: Wer dauerhaft hier lebt und arbeitet, sollte auch einzahlen können.
Fazit: Demografie ist keine Ausrede
Die These von der „nicht mehr sicheren Rente“ ist nur dann plausibel, wenn man zentrale Reformen bewusst unterlässt. Die Probleme des Rentensystems sind nicht biologischer, sondern politischer Natur. Wer auf die Babyboomer zeigt, verschleiert die eigentlichen Ursachen: Jahrzehntelange Entscheidungen, die das System ausgehöhlt haben, anstatt es zu stärken.
Es ist nicht zu spät, das zu ändern. Aber es braucht den politischen Willen, endlich alle einzubeziehen. Nicht nur beim Arbeiten – sondern auch beim Tragen der Verantwortung.